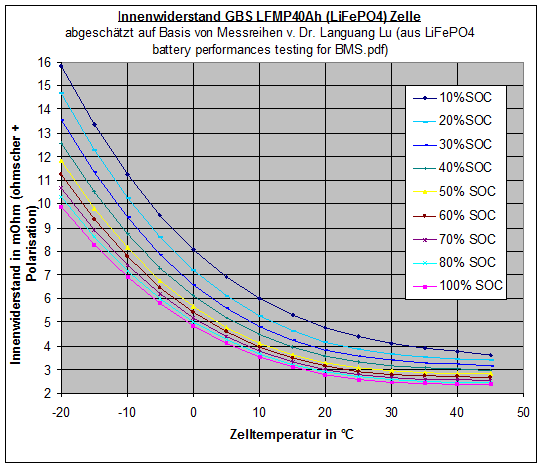Tim - STW, Alf und ich machen z.T. schon seit 10 Jahren mit elektrischen Zweirädern rum, vor allem mit von Lithium-Chemien betriebenen. D.h. wir kommen aus der Praxis, haben uns z.T. schon die Finger wund gemessen, Messfahrten und Ladevorgänge geloggt bei allen möglichen Temperaturen (-20 bis 33°Umgebungstemp. und Akku Temps. wirklich bis 40°C!) und Ladezuständen und in Excel penibel ausgewertet.
Und uns über die Jahre die nötigen Hintergrundinfos geholt, studiert und hier geteilt.
Wieviel reale Erfahrungen mit LiFeMnPO4, LiFeYPO4, LiFePo4, LiCo, NCM Zellchemien hat Dein Prof? Wieviele Messungen bei allen erwähnten Temperaturen und verschiedenen Lasten durchgeführt? Wir drei allein haben zusammen sicher über 100 000km reale Alltagserfahrung mit unseren Elektrorollern und -Motorrädern, bei jedem Wetter und verschiedenster Umgebungstemperatur.
Es gibt da teils sehr kuriose Zellchemien, aber eines haben sie ALLE gemeinsam. Es gibt nichts, was einen konstanten Innenwiderstand über dem Ladezustand aufweisen würde! Sogar Ladekurven, die mit sehr konstantem Strom gefahren werden, verlaufen nie gleichmäßig, da geht es mal ein bisschen rauf mit der Spannung (=> etwas erhöhter Innenwiderstand), dann wieder etwas herunter mit der Spannung (verringerter Innenwiderstand). Bei jeweils demselben Ladestrom. Ist auch klar warum: Lithium Ionen quälen sich aus Graphit heraus, durch die SEI Schicht, durch den Elektrolyt, den Separator, den Elektrolyt, nochmals eine "Abfallschicht", und dann in die Metalloxid-Elektrode rein. Je nachdem, wie voll der Graphit bzw. die Metalloxid-Elektrode jeweils sind tun sich die Lithium-Ionen leichter oder schwerer in der Interkalation. Dadurch verändert sich der Innenwiderstand über den Ladezustand ganz natürlich.
Die einfachste Art, den aktuellen (ohmschen) Innenwiderstand einer Zelle zu ermitteln: Leerlaufspannung vor Test messen (möglichst auf das mV genau), dann die Zelle mit einem konstanten Strom belasten, der gern über C/4 liegen darf und nach z.B. 10 Sekunden die Zellspannung messen, Last wegnehmen und ein paar Minuten warten, bis die Zelle wieder eine konstante Leerlaufspannung hat. Dann den Mittelwert aus Leerlaufspannung vor und nach dem Test bilden, davon die unter Last gemessene Spannung abziehen, und diesen SpannungsABFALL (nicht die Gesamtspannung...) durch den Entladestrom teilen. Da kommen dann x milli Ohm raus. Das ganze bei einer vollen, bei einer halbleeren und einer fast ganz leeren Zelle machen, und man sieht schön, wie mit sinkendem Ladezustand der Spannungsabfall bei gleichem Laststrom immer größer wird. D.h. der Innenwiderstand steigt mit sinkendem Ladezustand. Wenn die Zelle wärmer wird sinkt dagegen der Spannungsbfall, d.h. der Innenwiderstand nimmt ab. Und wenn die Zelle mal 0 oder gar -20°C hat steigen Spannungsabfall und Innenwiderstand auf häufig nicht mehr praxistaugliche Werte.
Klar wird der Innenwiderstand von Zellen hochprofessionell mit verschiedenen Frequenzen gemessen (Impedanz), aber auch da kommt verschiedenes raus bei verschiedenen Ladezuständen. Bei LiFePO4 recht stark verschiedenes, bei NCM und LiCo nicht ganz so verschiedenes.
Es gibt ein sehr eindrückliches Diagramm eines Chinesischen Wissenschaftlers, wie sich der Innenwiderstand einer LiFePO4 Zelle über Ladezustand und vor allem Zelltemperatur ändert. Kannst auch nach der im Diagramm erwähnten pdf suchen, um da etwas tiefer einzusteigen